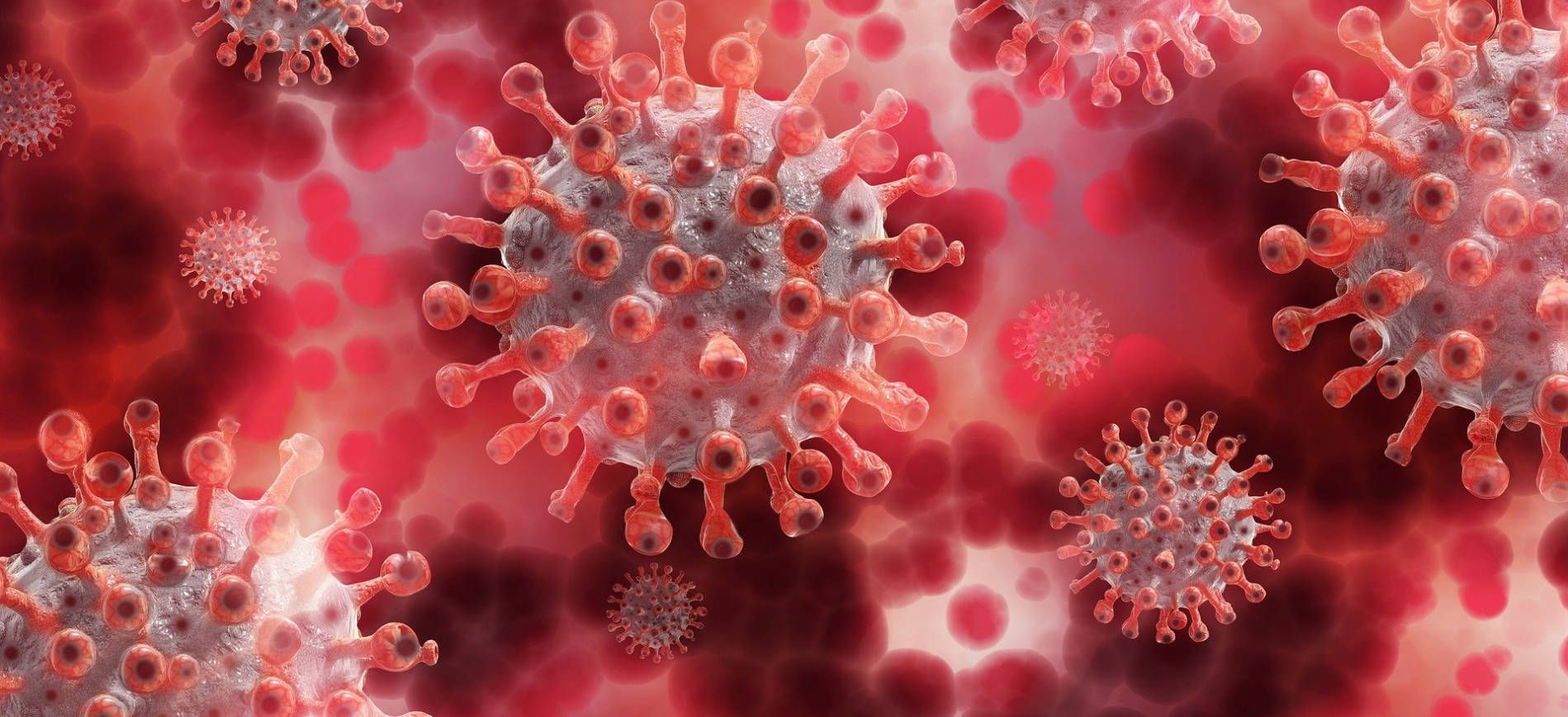»Die Frauen müssen das einfach wissen«
Moderne Brustkrebs-THerapie: »Ich hatte außerordentliches Glück«
5. Dezember 2023
Diesen Artikel können Sie kostenlos lesen, doch Journalismus ist nicht umsonst.
Wenn Ihnen der Text gefällt: Bitte helfen Sie mir mit Ihrer Spende, weitere Recherchen wie diese zu finanzieren.
Den ersten Anruf kann Jens-Uwe Blohmer nicht annehmen. Es ist der 6. Juli 2023, der Arzt ist auf dem Weg zu einem Kongress. Schnell tippt er auf sein Handy und löst eine SMS aus: „Kann ich später zurückrufen?“
„Ich dachte, es geht um etwas Belangloses“, erinnert sich der Gynäkologe, Direktor des Brustzentrums an der Charité, im Rückblick.
„Gerne – es ist aber dringend“, antwortet Yvonne Niepelt. Auch sie ist Ärztin.
20 Jahre lang hat die 52-Jährige ihren früheren Doktorvater nicht mehr gesehen. Unter Blohmer hate sie promoviert, ihn bei Studien zur Brustkrebstherapie unterstützt. Seither blieben sie nur lose in Kontakt, telefonierten alle paar Jahre und berichteten sich davon, was das Leben Neues gebracht hat.
Als Niepelt an diesem 6. Juli probiert, ob die alte Handynummer ihres früheren Professors noch funktioniert, ist sie im Ausnahmezustand. „Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen“, sagt sie heute.
Am Abend schließlich meldet sich Blohmer zurück – und erfährt den Grund ihres Anrufs: In der Nähe von Bremen, wo Niepelt heute wohnt, hatten Ärzte bei ihr einen großen Tumor in ihrer linken Brust festgestellt. Wie gut ihre Chancen stehen, weiß sie noch nicht. Die Ärztin rechnet mit dem Schlimmsten, doch auch der vermeintlich beste Fall – eine lange Chemotherapie – bereitet ihr Angst.
Dieser Moment ist es, der zwei Menschen, die nach Jahren der Zusammenarbeit getrennte Wege gingen, anscheinend schicksalhaft wieder zusammenführt. Vier Tage später meldet sich Blohmer erneut bei ihr. „Wir haben da was für Sie“, habe er am Telefon gesagt.
Niepelt erinnert sich an diese erlösenden Worte bei einem Treffen Anfang November, als wären sie gerade erst gefallen. Die Ärztin sprüht vor Energie. In ihrer Hand hält sie zwei Blister, einen mit hell-lilafarbenen Pillen, der andere mit kleinen, senfgelben Tabletten. Die, erklärt sie, haben sie vor einer Chemotherapie bewahrt: „Für viele Frauen wäre es eine maximale Erleichterung zu wissen, dass es das gibt.“ Davon zu erzählen, ist jetzt ihre Mission.
Bei jeder achten Frau wird Brustkrebs diagnostiziert
In den 1990er-Jahren kam Niepelt nach Berlin, um an der HU Medizin zu studieren. Es wurde ihr erster Berührungspunkt mit dem Thema Brustkrebs. „Ich wollte unbedingt gynäkologische Onkologin werden“, erzählt sie. „Warum, weiß ich nicht mehr – es ist, als sollte das so sein.“
Irgendwann suchte die junge Medizinerin eine Doktorandenstelle. Weil keine passende ausgeschrieben war, ging sie ins Studiensekretariat, wo man ihr von einem jungen Arzt erzählt, der Privatdozent werden sollte. Vielleicht habe der ja eine Stelle. Heute weiß sie: Sie war zur rechten Zeit am rechten Ort: Niepelt wurde Blohmers Mitarbeiterin.
Durch die Flure des Bettenhochhauses und des Brustzentrums der Charité bewegt sich Niepelt heute, als wäre sie nie weggewesen. „Sie haben eine neue Frisur!“, begrüßt der Gynäkologe die frühere Mitarbeiterin, die jetzt seine Patientin ist. Die kinnlangen, rötlichen Haare hat sie auf die linke Gesichtshälfte gescheitelt. „Vor allem sind das meine eigenen Haare“, sagt sie lachend, „und ich habe eigene Wimpern – da ist nichts ausgefallen.“
Mit dem Kuli tippt Blohmer auf das Ultraschallbild neben der Liege im Untersuchungsraum. Er ist zufrieden. Der Tumor ist von mehr als fünf auf weniger als zwei Zentimeter geschrumpft. Es dauert nicht lange, bis sich die Gespräche der beiden Ärzte nicht mehr um Befunde von Heute drehen. Sie schwelgen in alten Zeiten, erinnern sich an gemeinsame Studien über die Nebenwirklungen von Chemotherapien. Nebenwirkungen, die Niepelt jetzt erspart bleiben.
Während die junge Frau ihre Doktorarbeit schrieb, habilitierte sich Blohmer. In ihren Arbeiten befassen sich beide mit der Ultraschall-Diagnostik bei Brustkrebs. 2004, bei ihrer Verteidigung, sah die Ärztin ihren Doktorvater zum vorerst letzten Mal – und verabschiedete sich anschließend vom Thema Brustkrebs. „Wahrscheinlich hat mich die Arbeit mit den Frauen zu sehr berührt“, sagt sie. Niepelt ging als Anästhesistin nach München, heute ist sie Betriebsärztin und Strategieberaterin in Bremen.
Erst nach zwei Jahrzehnten sollte sie das Thema Brustkrebs wieder einholen. Jede achte Frau erhält im Laufe ihres Lebens die Diagnose Mammakarzinom, nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums jedes Jahr 70.000 Patientinnen in Deutschland. 2023 muss Yvonne Niepelt erfahren: Sie ist eine davon.
Die ersten Anzeichen gibt es im Februar, bei einem Urlaub auf Gran Canaria: „Mein Mann sagte: Du wanderst irgendwie langsamer.“ Niepelt schiebt das auf die Auswirkungen einer Corona-Infektion.
Im Mai spürt sie eine Verhärtung in ihrer Brust. Ein Vorbote der beginnenden Wechseljahre? Bei einer Radtour habe ihr Mann abermals gesagt: „Du bist aber langsam geworden.“ Im Juni ertastet sie einen dicken Lymphknoten unter ihrer Achsel.
An jenem 6. Juli, der Niepelt mit ihrem Doktorvater wieder zusammenführen soll, stellt sie sich zunächst in einem Brustzentrum in Norddeutschland vor. Die Ärzte drücken sich vorsichtig aus, sprechen von einem „Verdacht“, raten weitere Untersuchungen an. Doch Niepelt ist vom Fach. Als sie die Röntgenbilder sieht, ist sie sicher: „Das sieht aus wie ein großes Geschwür.“
Mehr als fünf Zentimeter groß ist der Tumor da bereits, die Ärzte des Brustzentrums halten eine Chemotherapie für unausweichlich. 16 Zyklen werden sie ihr empfehlen. Als sie die alte Handynummer ihres Professors anwählt, hat Niepelt die Klinik noch nicht einmal verlassen
„Wir brauchen keine Chemotherapie.“
Blohmer ist längst zum Leiter der gynäkologischen Klinik der Charité aufgestiegen. Zu schnell werde bei Brustkrebs auf Chemotherapie gesetzt, zu häufig radikale Operationen durchgeführt – so sieht er es. „Viele Patientinnen kommen zu mir wegen einer zweiten Meinung – und dann denke ich das hätte man schon anders machen können.“ Blohmer hat an den Zulassungsstudien für die Medikamente mitgearbeitet, die Niepelt jetzt auf milderem Wege helfen sollen.
„Das war schon komisch“, sagt der Professor über den Anruf seiner ehemaligen Doktorandin. „Runterkühlen auf Rationalität“, befiehlt er sich. Nur vier Tage später bespricht er Niepelts Befunde bereits mit Kollegen in einer so genannten Tumorkonferenz. Die Runde ist sich einig – vom Ergebnis berichtet Blohmer Niepelt am Telefon: „Wir brauchen keine Chemotherapie.“
„Ich bin vom Stuhl aufgesprungen und habe geweint vor Glück“, sagt sie.
Noch im Juli, nur eine Woche nach Blohmers Anruf, fährt Niepelt in die Charité und beginnt ihre Behandlung. Eine Sonderbehandlung ist das nicht, betont der Gynäkologe: „Wer einen Verdacht auf Brustkrebs hat, bekommt innerhalb von 48 Stunden einen Termin.“
Was der Charité-Arzt vorschlägt, ist keineswegs ein experimenteller Heilversuch. „Wir reden nicht von Wundermedikamenten, die erst seit gestern auf dem Markt sind“, so Blohmer. Sondern von einer Therapie, die seit Jahren in den ärztlichen Leitlinien steht und die die Krankenkassen übernehmen – auch wenn sie bislang nach Einschätzung des Gynäkologen bei Tumoren wie Niepelts relativ selten zum Einsatz kommt. In jenem Brustzentrum in Norddeutschland, in sie sich zunächst untersuchen ließ, habe man diese Option nicht näher einordnen können, sagt sie.
Wie die meisten Brusttumore entwickelt sich auch der Knoten in ihrer Brust hormonabhängig: Vor allem das Sexualhormon Östrogen regt sein Wachstum an. Entzieht man es ihm, kann er sich nicht weiter vergrößern.
Bei Niepelt geschieht dies mit zwei Wirkstoffen: Goserelin, das die Frau alle vier Wochen unter die Haut gespritzt bekommt und das die Östrogen-Produktion der Eierstöcke stoppt. Die senffarbenen Tabletten enthalten den zweiten Wirkstoff, Letrozol, der die Herstellung in anderen Organen verhindert.
Das allein würde jedoch nicht reichen. „Bisher war eine solche Anti-Hormontherapie bei schnellwachsenden Tumoren wenig wirksam“, erklärt Blohmer. Deshalb kombiniert er die beiden Präparate mit einem weiteren Medikament, dem so genannten CDK4/6-Hemmer. Aufgabe der lilafarbenen Tabletten ist es, jene Enzyme zu blockieren, die normalerweise die Zellteilung und das Zellwachstum fördern, auch das der Krebszellen.
Verbreitet ist diese Kombination vor allem bei breit streuenden Krebszellen, wo sie auch ergänzend zu einer Chemotherapie eingesetzt wird. Seit kurzem nutzen Ärzte sie auch bei „lokal fortgeschrittenen“ Karzinomen, bei größeren Tumoren also, die nur wenige Metasthasen bilden – wie bei Yvonne Niepelt.
„Bei uns ist das eine Routinetherapie“, sagt Blohmer. Bei etwa 60 Patientinnen im Jahr komme sie zum Einsatz. Der Klinikchef geht davon aus, dass sie gegenüber einer Chemotherapie sogar das Risiko senkt, dass der Krebs später zurückkommt. Warum auch anerkannte Brustzentren die Therapie nicht vorschlagen, irritiert ihn. Manche Kollegen würden die Dinge wohl weiter so machen, wie sie es immer gemacht haben.
Nur drei Wochen nach Beginn ihrer Therapie kann Niepelt die große Metasthase unter dem Schlüsselbein nicht mehr fühlen, auch das Wachstum des Tumors ist gestoppt.
Ohne Nebenwirkungen ist auch diese Behandlung nicht. Viele Patientinnen bekommen Durchfall, auch Haarausfall kann die Folge sein – jedoch deutlich seltener und weniger stark als bei einer Chemotherapie. Niepelt hat damit keine Probleme. Der Östrogenentzug ließ sie früher in ihre Menopause kommen, zudem sorgt der CDK4/6-Hemmer bei ihr für trockene Haut. „Das nehme ich gern in Kauf.“ Zugleich fühle sie sich deutlich besser als noch vor wenigen Wochen, als der Tumor ihren Körper schwächte, um selbst wachsen zu können. „Meine Energie kommt zurück“, berichtet Niepelt. Sie fährt schon wieder Rennrad mit ihrem Mann. Grund zu einer Bemerkung über ihr Tempo gibt sie ihm keinen mehr.
„Der Ansatz ist moderner, wir haben dazu aber noch wenig Evidenz“
„Ich hatte wirklich außerordentliches Glück“, sagt Niepelt. Sie ist sicher, dass sie längst mitten in einer belastenden Chemotherapie stecken würde, wäre sie durch eine Laune des Schicksals nicht vor 20 Jahren ihrem Doktorvater über den Weg gelaufen.
Der Brustkrebs-Experte Achim Wöckel hält Blohmers Vorgehen zum Ersatz der Chemotherapie für einen möglichen Weg – und ist dennoch zurückhaltender. „Der Ansatz ist moderner, wir haben dazu aber noch wenig Evidenz“, sagt der Direktor der Frauenklinik am Uniklinikum Würzburg. Bei metastasierenden Tumoren habe man mit der Kombinationstherapie aus Anti-Hormonen und CDK4/6-Hemmer „eindrucksvolle Erfolge“ erzielt. Entsprechende Daten lägen für weniger stark streuende, aber lokal fortgeschrittene Tumoren nicht vor, insbesondere, wenn sie vor einer Operation gegeben werde. Das gelte auch für langfristige Auswirkungen: Wenn eine Patientin auf eine Chemotherapie anspreche, sei davon auszugehen, dass die Aussichten auch langfristig positiv seien.
Wöckel hält deshalb auch die Empfehlung für eine Chemotherapie in Fällen wie Niepelts für „ein richtiges Schema“. Am Ende müssten Patientinnen und Ärzte gemeinsam abwägen, ob sie für die Aussicht auf geringere Nebenwirkungen eine größere Unsicherheit über die langfristigen Auswirkungen in Kauf nehmen wollten. Doch der Experte geht davon aus, dass die moderne Behandlungsmethode an Bedeutung gewinnen wird: „In den nächsten Jahren ist noch viel von diesen Therapien zu erwarten.“
An diesem Dienstag nun wird sich Yvonne Niepelt von Blohmer die Reste des Tumors aus ihrer Brust entfernen lassen, danach wird sie noch einige Jahre die anti-östrogenen Medikamente nehmen. Sie ist davon überzeugt, dass sie sich richtig entschieden hat. „Ich hoffe, dass sich das durchsetzt. Die Frauen müssen das einfach wissen“, sagt sie.
Dass sie selbst nur durch die Zufälle des Lebens von der Alternative zur Chemotherapie erfuhr, weil sie vor 20 Jahren ungeplant einem jungen Arzt begegnete, kann Niepelt kaum fassen. Wobei, was heißt schon Zufall? „Ich glaube nicht an Zufall“, sagt sie.
Blohmer pflichtet ihr bei. „Das ist schon eine dolle Story“, sagt er.
Diesen Artikel können Sie kostenlos lesen, doch Journalismus ist nicht umsonst.
Wenn es Ihnen der Text gefällt: Bitte helfen Sie mir mit Ihrer Spende, weitere Recherchen wie diese zu finanzieren.
Der Text erschien zuerst in der Berliner Zeitung. Bild: Alejandra Jimenez/Pixabay (modifiziert)
Newsletter
Mit meinem kostenlosen E-Mail-Newsletter informiere ich Sie über meine Arbeit und spannende Entwicklungen im Bereich der Verbraucherschutz-, Gesundheits- und Ernährungspolitik. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.